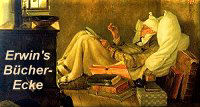Fotos und Informationen
aus der Oberpfalz
Waldsassen
Reiseberichte mit Bildern
| Zurück zu: | ➜ Oberpfalz |
| ➜ Deutschland |
Die Stiftsbasilika Waldsassen
Das markanteste Gebäude an einem zentralen Platz ist die beeindruckende Stiftsbasilika. Sie wurde von der Abtei der Waldsassener Zisterzienserinnen als barocke Klosterkirche gebaut und im Jahr 1704 fertiggestellt. Baumeister waren unter anderem Georg Dientzenhofer und Abraham Leuthner. Seit der Säkularisation im Jahr 1803 ist die Klosterkirche auch Pfarrkirche der katholischen Gemeinde Waldsassen.Die Katakomben
Unter der Klosterkirche von Waldsassen befindet sich ein Labyrinth von Katakomben. Es wurde so "gut" renoviert und ist so gut beleuchtet, dass nichts geheimnisvolles oder unheimliches übrig blieb. Die Steingewölbe wurden glatt verputzt. Für meinen Geschmack total überrenoviert.

Stiftsbibliothek Waldsassen
Schon das Eingangsportal lässt erahnen, was einen erwartet: Großartige Schnitzereien. Die heutige Ausstattung des Bibliotheksaals stammt aus den Jahren 1724 bis 1726. Die Empore stützen zehn meisterhaft geschnitzte lebensgroße Holzfiguren mit ihren Schultern. Sie sollen in allegorischer Darstellung die verschiedenen Formen des Hochmuts wie Eitelkeit, Heuchelei, Neugierde, Missachtung, Eigenbrötelei, Hoffahrt, Spott, Prahlerei, Zorn und Dummheit darstellen.Die geschnitzten lebensgroßen Figuren stammen von dem Waldsassener Schreiner Karl Stilp, der sie um 1724 anfertigte.

 Vom Innern kann ich nur ältere Bilder anbieten, da jetzt Fotografieren verboten ist und die Bibliothek nur mit Führungen betreten werden kann. Nicht nur die Schnitzereien sind sehenswert, auch die Wände und die Decke sind über und über mit Stuck, Fresken und Flachreliefs verziert. Die Deckengemälde stammen von dem Bayreuther Maler Karl Hofreiter. Sowohl der Holzschnitzer Karl Stilp als auch der Maler Karl Hofreiter waren auch im nicht weit entfernten
Vom Innern kann ich nur ältere Bilder anbieten, da jetzt Fotografieren verboten ist und die Bibliothek nur mit Führungen betreten werden kann. Nicht nur die Schnitzereien sind sehenswert, auch die Wände und die Decke sind über und über mit Stuck, Fresken und Flachreliefs verziert. Die Deckengemälde stammen von dem Bayreuther Maler Karl Hofreiter. Sowohl der Holzschnitzer Karl Stilp als auch der Maler Karl Hofreiter waren auch im nicht weit entfernten 
 Der Mann mit den Pluderhosen und dem verfilzten Bart stellt die Eigenbrötelei dar. Die Ärmel seiner Jacke sind zerfetzt. Er scheint ein rechter Sonderling zu sein, der sein Äußeres ziemlich vernachlässigt. In seinem Bart bauen die Mäuse schon ihr Nest und holen sich Kornähren als Vorrat.
Der Mann mit den Pluderhosen und dem verfilzten Bart stellt die Eigenbrötelei dar. Die Ärmel seiner Jacke sind zerfetzt. Er scheint ein rechter Sonderling zu sein, der sein Äußeres ziemlich vernachlässigt. In seinem Bart bauen die Mäuse schon ihr Nest und holen sich Kornähren als Vorrat.
Dieser Mann könnte seiner Kleidung nach ein Kirchenmann sein. Dem widerspricht jedoch das Fell um seine Beine und seine Hände sind gefesselt. Er bildet die Allegorie der Heuchelei. Auf seinem Kopf sitzt der Vogel der Selbsterkenntnis, der ihn in die Nase zwickt. Sein »Erkenne dich selbst!« oder »Nimm dich selbst bei der Nase« kann man eigentlich als Mahnung auf alle zehn Figuren beziehen. Wir kennen den Satz »Erkenne dich selbst!« heute wohl eher vom
Das Kloster Waldsassen
Links der Stiftsbasilika schließt sich das sogenannte Abtschloss an, rechts die Bibliothek und weitere Klostereinrichtungen wie ein Kreuzgang. Dahinter befindet sich der Stadtpark Schwanenwiese mit Klostergarten, Umweltstation und Wasserspielplatz.
Abtschloss, Stiftsbasilika und Stiftsbibliothek
Die Gründungslegende des Klosters Waldsassen
Im Stadtpark Schwanenwiese steht eine Skulptur, die einen auf einem Esel reitenden Mönch darstellt, und er reitet ziemlich forsch. Es ist eine Darstellung der Gründungslegende des Klosters Waldsassen. Historisch holte der Markgraf des Nordgaus, Diepold III. von Vohburg, um das Jahr 1133 Mönche aus dem Kloster Volkenroda in Thüringen, um mit ihnen ein Zisterzienserkloster zu gründen, das der Heiligen Jungfrau Maria geweiht wurde. Schon 14 Jahre später wurde es Zisterzienser-Abtei mit Reichsunmittelbarkeit.Der Legende nach hatte ein Mönch namens Gerwig mit einigen Gefährten in der Nähe in Köllergrün eine kleine Holzkapelle gebaut. Markgraf Diepold war sein Freund und versprach ihm so viel Land, wie er an einem Tag mit einem Esel umreiten konnte. Die Grenze markierten sie rundum mit einem Graben, der teilweise heute noch als Eselsgraben bekannt ist. Bei der Skulptur reitet er dabei wilde Fabelwesen nieder, die ihn daran hindern wollen, vielleicht sind das auch Symbole für Dämonen. Es handelt sich eigentlich um einen Brunnen. Im Trockenjahr 2018 lief jedoch im Herbst kein Wasser.
Hinter dem Kloster Waldsassen erstreckt sich der Stadtpark Schwanenwiese, wo sich auch der Klostergarten befand.


Die handwerkliche Glasherstellung
In meiner Heimatstadt Marktleuthen gab es auch eine Glashütte. Sie stellten vom Aschenbecher bis zum Parfum-Flakon Gebrachsgegenstände aus Glas her. Bei einer Vorführung in der Schule wurden Christbaumkugeln geblasen. Eine einfache Sache. Aber mundgeblasenes Fensterglas? Wie soll den das gehen, das muss doch flach sein? Es geht, wenn man weiß wie! Zu einem Tag des offenen Denkmals wurde es in der Glashütte Lamberts in Waldsassen vorgeführt.Weitere Bilder und Informationen:
(Vorführung zum Tag des Offenen Denkmals)
Die Dreifaltigkeitskirche Kappl (Kappel)

 Etwas außerhalb von Waldsassen findet man die Wallfahrtskirche der Heiligsten Dreifaltigkeit, kurz Kappl genannt. Georg Dientzenhofer versuchte hier 1685 architektonisch die Heilige Dreifaltigkeit darzustellen. Dazu plante er einen Rundbau mit drei Türmen und drei Dachreitern. Im gesamten Gebäude und in der Kirchenausstattung findet man überall die Zahl 3. Im Jahr 1711 wurde die Kappl geweiht.
Etwas außerhalb von Waldsassen findet man die Wallfahrtskirche der Heiligsten Dreifaltigkeit, kurz Kappl genannt. Georg Dientzenhofer versuchte hier 1685 architektonisch die Heilige Dreifaltigkeit darzustellen. Dazu plante er einen Rundbau mit drei Türmen und drei Dachreitern. Im gesamten Gebäude und in der Kirchenausstattung findet man überall die Zahl 3. Im Jahr 1711 wurde die Kappl geweiht.
Der älteste Vorgängerbau entstand schon im 12. Jahrhundert um ein Dreifaltigkeitsbild an einem Baum, das angeblich Wunder bewirkte. Die Kappl wurde mehrfach beschädigt und fast zerstört. Die Hussitenkriege, der Landshuter Erbfolgekrieg und der Dreißigjährige Krieg brachten auch Jahrzehnte des Verfalls. Erst zum Ende des 17. Jahrhunderts entstand das heutige Erscheinungsbild. Im Innenraum zeigen drei Kuppelbilder die Heilige Dreieinigkeit: Gott Vater, Gott Sohn und den Heiligen Geist.
In den Bildern unten schwebt der Heilige Geist als Taube über bunt gemischtem Volk. Bei näherer Betrachtung ist man jedoch irritiert: Da finden sich Soldaten mit Gewehr und Stahlhelm, wie sie im 20. Jahrhundert eingesetzt waren, und Rot-Kreuz-Schwestern, vermischt mit antik gekleideten Personen. Der Grund liegt darin, dass der Dachstuhl der Kappl um 1880 abbrannte. Die Deckenbilder malte der fränkisch-bayerische Maler Oskar Martin-Amorbach in den Jahren 1934 bis 1940, wobei er Personen der Zeitgeschichte darstellte, unter vielen anderen auch Martin Luther und Adolf Hitler. Manche erkennt man an beigefügten Gegenständen, wie zum Beispiel Moses mit den Gesetzestafeln oder die römischen Soldaten am Grab Jesu nach der Auferstehung, und manche Gesichter entsprechen historischen Darstellungen.
Das Stiftland
Die alte Klosterstadt Waldsassen liegt im nordöstlichen Bayern, in der Oberpfalz, im Landkreis Tirschenreuth, nicht weit von der tschechischen Grenze im sogenannten Stiftland. Vom 12. Jahrhundert bis zur Reformation gehörte das ganze Umland dem Kloster Waldsassen. Sogar die heutige Kreishauptstadt Tirschenreuth gehörte dazu. Üppig fließende Einnahmen aus dem Ablasshandel, Spenden von Novizinnen und Erbschaften machten das Kloster und damit auch die katholische Kirche zum Großgrundbesitzer. Auch das Vermögen von Ketzern, die von der Inquisition zum Tode verurteilt wurden, fiel an die Kirche. Die Bauern waren nur Pächter ihrer Höfe, mussten den Zehnt (Zehent) abgeben und Frondienste leisten.Auch ein Teil meiner Heimatstadt
Schon vorher, und über viele Jahrhunderte, hatte das Kloster Waldsassen großen Einfluss auf das Fichtelgebirge und das heutige Nordostbayern. Sie ließen Sümpfe trockenlegen, Fischteiche anlegen, verbesserten die Verkehrswege und begünstigten damit die Besiedelung schon ab dem 11. Jahrhundert. Erst die Bayreuther Markgrafen sorgten für eine endgültige Abgrenzung. Der Norden wurde protestantisch und stand einige Jahrhunderte unter preußischem Einfluss. Auch heute noch ist die Trennlinie als die Grenze zwischen Oberfranken und der Oberpfalz erkennbar.
Die Lourdesgrotte bei Waldsassen
Im Jahr 1905 baute die Familie Rockstroh östlich von Waldsassen eine Lourdesgrotte. 1988 wurde sie von der Kolpingfamilie Waldsassen restauriert. Lourdesgrotten gibt es überall auf der Welt. Es handelt sich um Nachbildungen der Originalgrotte von Massabielle bei Lourdes in Südfrankreich, wo 1858 eine Frau nahe der Grotte Massabielle (Massevieille) Erscheinungen einer weiß gekleideten Frau gehabt haben, die sich als Jungfrau Maria herausstellte. Alle Nachbildungen sind unserer lieben Frau in Lourdes geweiht. In einer Felsnische steht die Muttergottes, die Madonna. Gebetststafeln und Dankschreiben sind an die Wände geheftet. Man kann über die Marienverehrung oder die Religion an sich natürlich streiten, aber wenn es Menschen hilft oder ihnen gut tut, warum nicht? Unten rechts eine teilweise verbrannte Kerze mit der trauernden Maria mit Jesus wie bei einer Pieta.
Die Katakombenheiligen
Als etwas makabere Besonderheit findet man im Innenraum der Stiftsbasilika Waldsassen zwölf sogenannte Katakombenheilige. Dabei handelt es sich um menschliche Skelette, die wahrscheinlich zur Zeit des Neubaus am Anfang des 18. Jahrhunderts aus den Katakomben in Rom genommen und hierher transportiert wurden. Sie sind in kostbare goldene Gewänder gekleidet, hinter Glas ausgestellt und stammen aus den ersten Jahrhunderten des des frühen Christentums. Ihre Namen und ihre Geschichte sind bekannt und im Archiv festgehalten. Sie sind als Heilige Leiber in prächtig ausgestatteten Reliquienschreinen zu sehen. Nirgendwo sonst in Mitteleuropa findet man eine solche Sammlung von Ganzkörper-Reliquien frühchristlicher Märtyrer. Die Anzahl der Skelette wird zwar vom ➜ Beinhaus in Sedlec bei Kutná Hora in ➜ Tschechien weit übertroffen, jedoch sind die menschlichen Knochen dort nicht als ganze Körper dargestellt, sondern nach Körperteilen sortiert kunstvoll angeordnet.
Ein Skelett in Waldsassen ist eine Frau, die Heilige Ursa. In der rechten Hand hält sie einen Kelch, der als Blutgefäß ihr Martyrium symbolisiert und in der linken Hand hält sie einen Lilienzweig als Symbol für Reinheit, Unschuld und Jungfräulichkeit. Sie war also Märtyrerin und Jungfrau.
Ob es heute noch angebracht ist, Gottesdienstbesucher einschließlich Kinder mit diesem Anblick zu konfrontieren, darüber kann man sicher streiten. Früher diente es dazu, die Menschen mit der Angst vor dem endgültigen Tod an die Kirche zu binden und mit Drohungen von Satan und Fegefeuer Macht über sie auszuüben. Bei den Bildern handelt es sich um ältere Dias von ca. 1980, da das Fotografieren jetzt verboten ist.
Ob es heute noch angebracht ist, Gottesdienstbesucher einschließlich Kinder mit diesem Anblick zu konfrontieren, darüber kann man sicher streiten. Früher diente es dazu, die Menschen mit der Angst vor dem endgültigen Tod an die Kirche zu binden und mit Drohungen von Satan und Fegefeuer Macht über sie auszuüben. Bei den Bildern handelt es sich um ältere Dias von ca. 1980, da das Fotografieren jetzt verboten ist.
Leichenkonservierung
Besonders bei hochgestellten Persönlichkeiten wurden die sterblichen Überreste oft konserviert, durch Einbalsamierung und Mumifikation. Besonders das Alte Ägypten ist bekannt für die Mumifizierung von Leichen, die dort bis zur Perfektion weiterentwickelt wurde. Wenig bekannt ist, dass sich im Keller des Luisenburg-Gymnasiums in Wunsiedel eineEs gibt aber auch natürliche Konservierung, zum Beispiel wenn die Leichen schnell trocknen und nicht verwesen können. Oder aber bei Moorleichen, wo sauerstoffarmes Wasser keine Verrottung zulässt und diese dann als Moorleichen, oft erst nach Jahrhunderten, wieder auftauchen. Bei Skeletten oder Skelett-Teilen in Beinhäusern oder Kirchen handelt es sich meist um ausgegrabene Tote, um auf dem Friedhof Platz für neue Gräber zu schaffen. Oft gab es dafür auch Beinhäuser (Ossuarien), wie im Keller der alten Friedhofskapelle in
Das Leichenkochen
Starb jedoch eine wichtige Persönlichkeit fernab seiner Heimat, sollte aber daheim bestattet werden, war die Verwesung auf dem Transport ein Problem, da es keine Kühlmöglichkeiten gab. Besonders im Mittelalter wurden solche Toten dann gekocht, bis sich das Fleisch von den Knochen löste. Als Lothar III., Herzog von Sachsen, König und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation auf dem Rückweg von einem Feldzug in Italien 1137 im Dorf Breitenwang in Tirol starb, entfernte man seine Eingeweide und kochte ihn dann längere Zeit, bis sich die Knochen von dem Fleisch lösen ließen. Anscheinend hatte man entsprechend große Töpfe dabei, um das Heer zu verpflegen. Sein Skelett bestattete man schließlich daheim in Niedersachsen in der Stiftskirche Peter und Paul in Königslutter. Warum dieses Konservierungsverfahren für Leichen ausgerechnet als Mos teutonicus (deutsche Sitte) bekannt wurde, darüber kann man nur spekulieren.Bekannt wurde das Verfahren auch bei
Das oben erwähnte Zisterzienserkloster in Sedletz in Böhmen wurde übrigens im Jahr 1142 vom Kloster Waldsassen gegründet. Dort findet man neben den kunstvoll angeordneten Menschenknochen im Beinhaus auch ein Ganzkörper-Skelett des Heiligen Felix in der Klosterkirche. Ein weiteres Beinhaus mit sortierten Knochen bestimmter Körperteile findet man in Portugal: Die  Capela dos Ossos in Évora, im Alentejo, der Landschaft jenseits des Flusses Tejo.
Capela dos Ossos in Évora, im Alentejo, der Landschaft jenseits des Flusses Tejo.
Bücher über die Oberpfalz
Meine Bücherecke:
➜ Oberpfalz
➜ Wellness
➜ Gesundheit und Medizin
➜ Fichtelgebirge
➜ Wandern, Radwandern
➜ Radkarten und Radwanderführer
➜ Wanderkarten und Wanderführer
➜ Oberpfalz
➜ Wellness
➜ Gesundheit und Medizin
➜ Fichtelgebirge
➜ Wandern, Radwandern
➜ Radkarten und Radwanderführer
➜ Wanderkarten und Wanderführer
Der Shop meiner Tochter:
➜ Oberpfalz
➜ Wellness
➜ Gesundheit und Medizin
➜ Fichtelgebirge
➜ Wanderausrüstung
➜ Radkarten und Radwanderführer
➜ Wanderkarten und Wanderführer
➜ Oberpfalz
➜ Wellness
➜ Gesundheit und Medizin
➜ Fichtelgebirge
➜ Wanderausrüstung
➜ Radkarten und Radwanderführer
➜ Wanderkarten und Wanderführer
| Bücher | Elektronik, Foto |
| Musik-CDs | DVDs, Blu-ray |
| Spielzeug | Software |
| Freizeit, Sport | Haus und Garten |
| Computerspiele | Küchengeräte |
| Essen und Trinken | Drogerie und Bad |