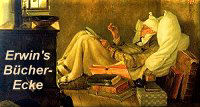Bilder und Informationen
aus Mittelfranken
Gunzenhausen
Römisches Numeruskastell
|
Zurück zu: |
|
|
|
Die Stadt Gunzenhausen liegt in Mittelfranken im sogenannten Fränkischen Seenland, und ist staatlich anerkannter Erholungsort am  Altmühlsee. Bekannt ist es auch durch seine Altmühlseeklinik Hensoltshöhe, die sich auf Reha und Anschlussheilbehandlungen spezialisiert hat.
Altmühlsee. Bekannt ist es auch durch seine Altmühlseeklinik Hensoltshöhe, die sich auf Reha und Anschlussheilbehandlungen spezialisiert hat.
Bis ins 3. Jahrhundert nach Christus führte beim heutigen Gunzenhausen der Raetische Limes vorbei, wahrscheinlich entlang der Altmühl, über die hier eine Furt führte. An der Stelle der heutigen Stadt befand sich ein römisches Militärlager zur Bewachung des Raetischen Limes.
Bis ins 3. Jahrhundert nach Christus führte beim heutigen Gunzenhausen der Raetische Limes vorbei, wahrscheinlich entlang der Altmühl, über die hier eine Furt führte. An der Stelle der heutigen Stadt befand sich ein römisches Militärlager zur Bewachung des Raetischen Limes.
Das Kastell Gunzenhausen
Auf einem langgezogenen Hügel östlich der heutigen Stadt Gunzenhausen, dem Schlossbuck (Schloßbuck), fand man Grundmauern eines kleinen römischen Kastells (Castrum Romanum), ein Numeruskastell, und Überreste von römischen Wachtürmen aus Stein und Turmhügel von hölzernen Wachtürmen. Ein Numerus ist eine Untereinheit der römischen Truppen, die ca. 150 Soldaten umfasste. Das eigentliche Militärlager ist heute vollständig von der Stadt überbaut. Die Römer bewachten hier auch die Furt über den Fluss, der heute Altmühl heißt. Der Bergrücken ist bewaldet und durchzogen von Wanderwegen. Überall findet man tiefe Gräben und Wälle, größteneils Erdbewegungen aus römischer Zeit.
Bei archäologischen Ausgrabungen fand man die Grundmauern zweier Limes-Wachtürme, die offenbar erst um das Jahr 200 nach Christus gebaut wurden, also nur wenige Jahrzehnte vor der Aufgabe des Raetischen Limes. Möglicherweise versuchte man durch Verstärkung der Grenzbefestigungen diese Verteidigungslinie gegen die barbarischen Völker doch noch halten zu können. Wahrscheinlich wurde von den Türmen aus die Talsenke und die Furt überwacht. Im 3. Jahrhundert nahmen die Angriffe durch germanische Stämme zu, und Mitte dieses Jahrhunderts gerieten die Römer durch die Germanenzüge in Bedrängnis. Zur heutigen Verdeutlichung hat man die Steinturmfundamente teilweise mit den noch gefundenen Original-Bausteinen restauriert.
Raetischer Limes
Der Obergermanisch-Raetische Limes führte über Land von der Donau bis zum Rhein. Davor und danach bildeten diese beiden Flüsse die Grenze zwischen dem Römischen Reich und dem Siedlungsgebiet germanischer Stämme, das die Römer Germania magna nannten, heute auch oft einfach als Germanien bezeichnet. Der gesamte Raetische Limes ist heute UNESCO-Weltkulturerbe. Oft wird er als Rätische Mauer bezeichnet, von dieser Mauer ist aber nur wenig übrig, da sie über die Jahrhunderte als Steinbruch für die Gewinnung von Baumaterial verwendet wurde. Der Name kommt von der römischen Provinz Raetia, die von hier Richtung Süden bis in die Alpen reichte. Bewohnt wurde sie von den geheimnisvollen Rätern, von denen man annimmt, dass sie von aus dem Süden vertriebenen, also verwilderten Etruskern abstammen. Man schließt das vor allem aus sprachlichen Ähnlichkeiten der Rätischen und der Etruskischen Sprachen.Bereits im 3. Jahrhundert nach Christus konnte der Raetische Limes von den Römern nicht mehr gehalten werden, und die Römer zogen sich im Lauf dieses Jahrhunderts nach und nach südlich der Donau und westlich des Rheins zurück. Die neue Grenzlinie nennt man den Donau-Iller-Rhein-Limes.
Zwei Gedenksteine erinnern an das römische Militärlager bei Gunzenhausen:
Ein älterer mit der Aufschrift: »Überreste eines römischen Castrums«
Ein neuer mit der Aufschrift: »Castrum Romanum«
Ein älterer mit der Aufschrift: »Überreste eines römischen Castrums«
Ein neuer mit der Aufschrift: »Castrum Romanum«
Simon Marius

Simon Marius 1614 im Alter von 42 Jahren, Hofastronom, Hofmathematikus und Medicus in Ansbach, geboren in Gunzenhausen, Abb.: gemeinfrei
Vor sich Instrumente als Symbole für seine Tätigkeiten: Ein Fernrohr für die Astronomie/Astrologie, ein Büchlein, vielleicht mit seinen Berechnungen, und in der linken Hand ein Destillierkolben mit aufgestecktem Destillierhelm, einem Alembic, zur Herstellung medizinischer Essenzen.
Fürst Joachim Ernst von Brandenburg-Ansbach war Markgraf des fränkischen Fürstentums Ansbach. Er wurde auf den 1573 in Gunzenhausen geborenen, tüchtigen und begabten Simon Mayr (später Simon Marius) aufmerksam. Ab 1586 ließ er ihn die Fürstenschule Heilsbronn besuchen, wo sich sein außergewöhnliches Talent für Astronomie und Mathematik zeigte. Als 1596 der Komet C/1596 N1 am Nachthimmel erschien, beobachtete Marius ihn und seine Bahn akribisch und schrieb einen Bericht, der international Beachtung fand. Er rief allerdings auch Kritik hervor, da er neben modernen himmelsmechanischen Beschreibungen auch astrologische Überlegungen aufnahm (Quelle: harvard.edu).
Im Jahr 1606 wurde Simon Marius fürstlicher Hofastronom, Hofmathematikus und Medicus in Ansbach. Astronomie und Astrologie darf man in dieser Zeit nicht getrennt betrachten. Als Hofmathematiker war er gleichzeitig Astrologe und verfasste zum Beispiel Kalender mit astrologischen Vorhersagen. Parallel dazu übersetzte er Schriften des griechischen Mathematikers Euklid aus dem Altgriechischen ins Deutsche.
Auf Astrologie und astrologischer Mathematik basierende Medizin
Als Mathematikus beherrschte er auch die damals noch allgemein anerkannte Iatromathematik, eine auf Astrologie basierende Medizin, die sich mit "Wissenschaften" wie Astromedizin und Iatroastrologie befasste. Die zwölf Tierkreiszeichen und deren jeweilige Stellung hatten Einfluss auf bestimmte Regionen des menschlichen Körpers. Damit versuchte ein Medicus den menschlichen Körper und seine Krankheiten zu kurieren. Eine Verbindung zwischen Medizin, Astrologie und Mathematik, die wir heute als gefährlicheDas Sonnensystem, geozentrisch oder heliozentrisch?
1609 erhielt Simon Marius ein Fernrohr aus Flandern und entdeckte fast gleichzeitig wie Galileo Galilei vier große Jupiter-Monde. Galilei zog aus den Beobachtungen die richtigen Schlüsse, nämlich dass sich die Planeten, einschließlich der Erde als einer von ihnen, um die Sonne drehen. Nicolaus Copernicus hatte das schon 5 Jahrzehnte früher behauptet, das heliozentrische Weltbild eben.Simon Marius versuchte statt dessen seine Beobachtungen mit dem geozentrischen Weltbild in Einklang zu bringen, dadurch musste er sich nicht mit der Kirche anlegen. Galileo Galilei wurde sehr viel bekannter und berühmter, vor allem durch seine Konflikte mit der Kirche, deren mächtigste Männer das Kopernikanische Weltbild vehement ablehnten. Simon Marius dagegen geriet in den folgenden Jahrhunderten mehr oder weniger in Vergessenheit.
Johann Agricola
Ein weiterer Sohn der Stadt ist erwähnenswert: Johann Agricola, geboren 1496 in Gunzenhausen, war an der Universität Ingolstadt Professor der griechischen Sprache und Professor der Medizin. Nicht verwechseln darf man ihn mit dem bekannteren Georgius Agricola aus Glauchau in Sachsen, der mit seinen Werken über Mineralogie und Montanwissenschaften berühmt wurde.Durch seine griechischen Sprachkennnisse befasste sich Johann Agricola mit den historischen Schriften der antiken Ärzte, wodurch er maßgeblich an der Reform der Heilkunde, weg von mittelaterlichen Praktiken hin zu neuzeitlichen, aufklärerischen Heilmethoden beteiligt war. Außerdem verfasste er ein umfangreiches Werk über Heilpflanzen, in dem er sich u.a. mit den je nach Gegend unterschiedlichen Bezeichnungen der pharmazeutischen Pflanzen beschäftigte.
Bücher über Franken
Meine Bücherecke:
 Franken
Franken
 Deutschland
Deutschland
 Deutsche Geschichte
Deutsche Geschichte
 Wandern, Radtouren
Wandern, Radtouren
Sport und Freizeit:
 Fahrradausrüstung
Fahrradausrüstung
 Fahrräder
Fahrräder
 Thema Fahrrad bei Amazon
Thema Fahrrad bei Amazon
Sport und Freizeit:
Der Shop meiner Tochter:
 Franken
Franken
 Bayern
Bayern
 Reiseberichte Deutschland
Reiseberichte Deutschland
 Deutsche Geschichte
Deutsche Geschichte
 Bildbände
Bildbände
 Reiseführer
Reiseführer
 Kartenmaterial
Kartenmaterial
 Wanderkarten, Wanderführer
Wanderkarten, Wanderführer
| Bücher | Elektronik, Foto |
| Musik-CDs | DVDs, Blu-ray |
| Spielzeug | Software |
| Freizeit, Sport | Haus und Garten |
| Computerspiele | Küchengeräte |
| Essen und Trinken | Drogerie und Bad |